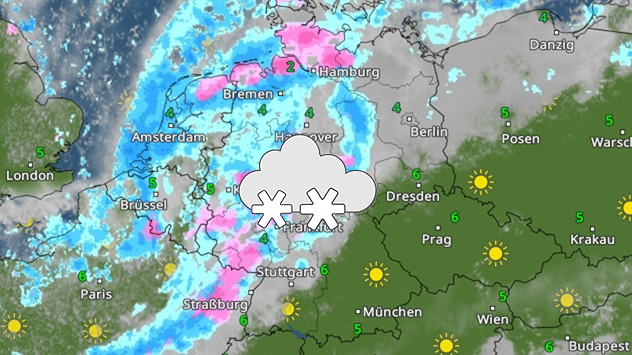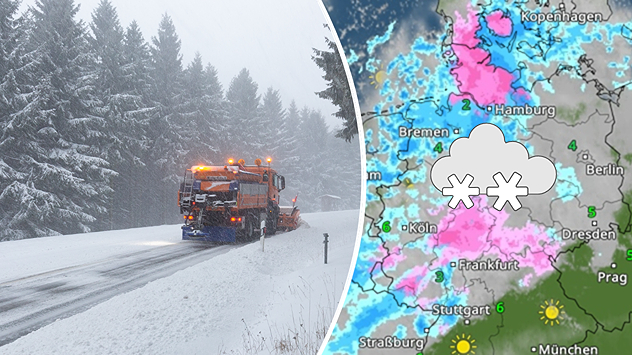Welttag der Feuchtgebiete
Moore sind wertvolle "Klimaschützer"

Feuchtgebiete spielen eine wichtige Rolle für das Klima. Die Renaturierung ist ein effektiver Beitrag gegen die fortschreitende Erderwärmung. Auch die Wasserqualität kann sich dadurch verbessern.
Feuchtgebiete wie Moore wurden lange Zeit trockengelegt, um Flächen für die Landwirtschaft zu gewinnen. Aber auch die großflächige Entwässerung hat Folgen für das Klima und die biologische Vielfalt. Doch Moore haben eine für das Klima wichtige Eigenschaft, denn sie speichern große Mengen an Kohlenstoff, sogar viel mehr als alle anderen Ökosysteme der Welt.
Moore bestehen aus Biomasse, die wegen der Feuchtigkeit nicht vollkommen zersetzt wurde. Diese Biomasse wird als Torf bezeichnet. Trocknet der Torf, setzt er erhebliche Mengen an Treibhausgasen wie Kohlendioxid, Methan und Lachgas frei. Der Grund ist die verstärkte Zersetzung von organischen Materialien des Moorbodens durch Bakterien und Mikroorganismen.
Ob Methan oder Kohlendioxid freigesetzt wird, hängt von der Höhe des Wasserspiegels ab. Bei erhöhten Temperaturen, aber immer noch hohem Wasserspiegel, wird Methan verstärkt emittiert. Methanausgasung gibt es auch unter normalen natürlichen Bedingungen auf Mooren. Durch Erwärmung wird der Prozess jedoch zusätzlich angetrieben.
Bei einem gesunkenen Wasserspiegel und durch Zufuhr von Sauerstoff entsteht Kohlendioxid. Beide freigegebenen Gase enthalten Kohlenstoff. Aus trockeneren und an Stickstoff reichen Mooren entweicht außerdem Lachgas (N2O). Auf diese Weise können die der Atmosphäre durch Jahrtausende entnommenen Stoffe (Kohlenstoff und Stickstoff) bei einer Erwärmung verhältnismäßig schnell in die Atmosphäre zurück gelangen. Dies verstärkt den Treibhauseffekt.
So entsteht eine Spirale, denn auch die Moore sind vom Klimawandel bedroht. In trockenen und warmen Jahren verlieren die Feuchtgebiete Wasser. Das gesamte Ökosystem reagiert darauf empfindlich. Durch zerstörte Moore sind außerdem Tiere und Pflanzen bedroht.
Moore auf der Welt und in Deutschland
Laut dem BUND bedecken Moore nur drei Prozent der Erdoberfläche, speichern aber rund 30 Prozent des erdgebundenen Kohlenstoffs. Pro Hektar binden sie viermal mehr CO2 als die Tropenwälder. Dadurch wirken sie der Klimaerwärmung entgegen. Aus dieser Erkenntnis heraus wird inzwischen im Sinne der Klimarettung daran gearbeitet, einige Moorflächen wieder zu vernässen und zu renaturieren.
In Deutschland gelten nur noch 5 Prozent der ehemals 1,5 Millionen Hektar Moorfläche als naturnah. Allein aus entwässerten deutschen Mooren entwichen jährlich rund 45 Millionen Tonnen CO2.
Forscherinnen und Forscher arbeiten seit Jahren an einem Konzept zur nachhaltigen Bewirtschaftung nasser Flächen. Seit hunderten von Jahren wurden Moore für den Menschen zum Torfabbau genutzt und trockengelegt, um Flächen für die Landwirtschaft zu gewinnen. Nicht nur die Trockenlegung der Moore für die landwirtschaftliche Nutzung ist ein Problem, sondern auch der immer noch andauernde Torfabbau.
Die Wissenschaftler fanden heraus, dass eine 15 Zentimeter mächtige Torfschicht in Deutschland in etwa gleich viel Kohlenstoff wie ein 100-jähriger Wald auf gleicher Fläche enthält. Geht also im Umkehrschluss die Torfmächtigkeit in einem Moor um einen Meter zurück, wäre es notwendig das Sechsfache an Fläche aufzuforsten und 100 Jahre wachsen zu lassen, um einen Ausgleich zu erreichen.
Die Kosten für die Wiedervernässung von Mooren liegen zwischen 40 und 110 Euro pro Tonne Kohlendioxid. Wenn zum Beispiel 300.000 Hektar Moorböden in Deutschland wieder vernässt werden, ließen sich volkswirtschaftliche Schäden von 217 Millionen Euro pro Jahr vermeiden.
Um den Wasserhaushalt von Mooren wiederherzustellen, genügen meist einfache Holzdämme. Dadurch wird auch ihre CO2-Speicherfähigkeit zurückzugeben. Vom Torfabbau erholen sich Moore nur sehr schlecht. Daher kann jeder Mensch einen kleinen Teil zur Rettung der Moore beitragen, indem er torffreie Blumenerde vorzieht.
Moorschutz verbessert Wasserqualität
Ein weiterer Nebeneffekt beim Schützen der Moore ist in Deutschland ebenfalls zu beobachten: Die Wasserqualität wird in Gewässern und vor allem an der Ostsee besser, denn Moore fungierten als Nährstofffilter.
Bei trockengelegten Moore wiederum werden Nährstoffe freigesetzt, die dann in die Gräben an den Feldern, in die Flüsse und dann schließlich ins Meer fließen. Der Nährstoffeintrag in der Ostsee ist schon seit Jahrzehnten bedenklich hoch. Wenn Moore im erforderlichen Umfang wieder vernässt werden, dürfte sich die Wasserqualität auch dort verbessern.
1/10
"O schaurig ist´s übers Moor zu gehen", schrieb die Dichterin Annette von Droste-Hülshoff 1842. Vor allem im Herbst und Winter mit seinen Nebelschwaden, welkenden Pflanzen und dunklem Wasser vermag ein Moor gespenstische Faszination auszuüben. Wir stellen Ihnen ein paar Moore in Deutschland vor.