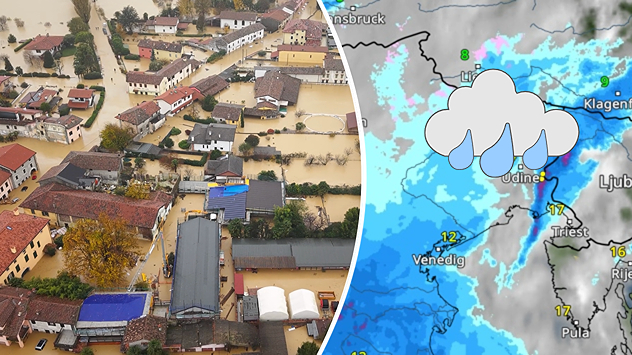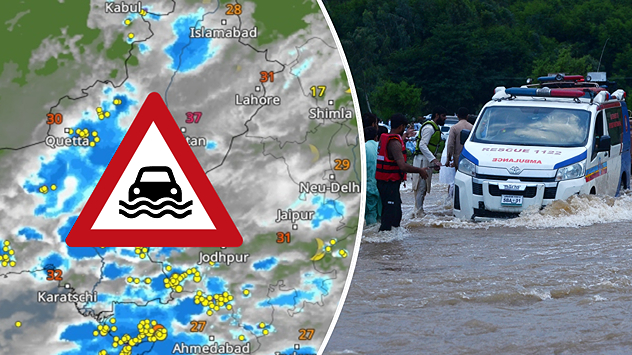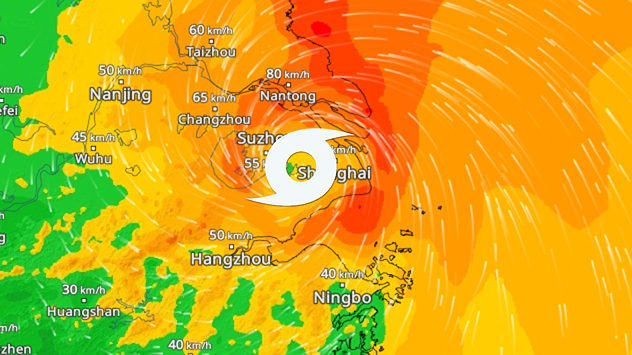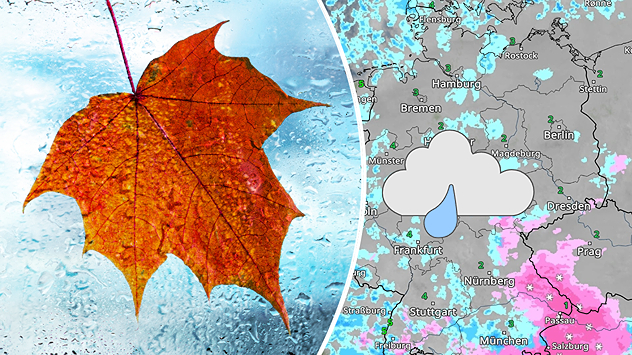Schneesturm im Doppelpack
Der Jahrhundertwinter 1978/79
 © Kai Greiser
© Kai GreiserMit einem extremen Temperatursturz von plus 10 auf bis zu minus 20 Grad ist zum Jahreswechsel 1978/79 die schlimmste Schneesturmkatastrophe der vergangenen 100 Jahre über Mitteleuropa hereingebrochen. Weite Teile Norddeutschlands erstarrten unter meterhohen Schneeverwehungen.
Vorangegangen war der extremen Kältewelle ein massives Weihnachtstauwetter mit starkem Regen bis in die Gipfellagen der Mittelgebirge hinauf. Viele Flüsse führten deshalb zwischen den Jahren Hochwasser und in den Alpen schmolz der Schnee bis in über 2000 Meter Höhe.
Am Morgen des 29. Dezember war es am Oberrhein bei Südwestwind noch plus 10 Grad mild, während der äußerste Norden Deutschlands bei eisigem Nordoststurm bereits von sibirischer Frostluft überrollt wurde.
Kurz darauf bildete sich über den nördlichen Mittelgebirgen eine scharfe Luftmassengrenze, an der bis zur Neujahrsnacht mehrere Randtiefs nach Osten zogen. Sie brachten im Süden sintflutartigen Regen, der Norden versank dagegen im Schnee.
Direkt an der Luftmassengrenze schob der Nordoststurm eine nur wenige Hundert Meter dicke Schicht aus Frostluft wie einen Keil unter die milde Höhenluft, sodass stundenlanger, massiver Eisregen extremes Glatteis verursachte, bevor der Schneesturm begann.
Vor allem dieser von gefrierendem Regen verursachte Eispanzer war es, der zu massiven Problemen führte. Windschutzscheiben von Autos vereisten binnen Minuten, Straßen verwandelten sich in spiegelglatte Eisbahnen und wurden unpassierbar.
Extremer Temperatursturz zu Silvester
Die Weichen der Gleisanlagen der Bahn froren ein und ließen sich nicht mehr schalten. Dann kam der Schneesturm. Flughäfen mussten geschlossen und selbst der Fährverkehr eingestellt werden.
Am Silvestertag verschärften sich die Temperaturunterschiede weiter und erreichten auf wenigen Dutzend Kilometer teils über 15 Grad. Zugleich setzte sich die Front südwärts in Bewegung und erfasste nachmittags die zentralen Mittelgebirge.
Bis zum Neujahrsmorgen flutete sie mit einem Temperatursturz um rund 25 Grad auch den gesamten Süden des Landes. Eis und Schnee legten auch dort den Verkehr lahm und nur weil die Eisfront inzwischen Fahrt aufgenommen hatte, waren die Folgen nicht ganz so schlimm wie zuvor im Norden.
In Schleswig-Holstein und auf der Insel Rügen, wo der Schneesturm bei arktischen Minusgraden mehr als 72 Stunden lang tobte, blockierten meterhohe Schneeverwehungen alle Verkehrsverbindungen.
Ganze Landstriche waren von der Außenwelt abgeschnitten, das Strom- und Telefonnetz teils zusammengebrochen und Tausende Menschen mit ihren Autos oder in Zügen der Bahn in den Schneemassen stecken geblieben.
In vielen Ostseehäfen hatte der Sturm zudem Hochwasser in die Buchten gedrückt und Eisschollen zu meterhohen Eisbarrieren aufgetürmt. Im nördlichsten Bundesland war Katastrophenalarm ausgelöst worden.
Wasserleitungen waren eingefroren und zahllose Haushalte ohne Strom und Heizung. Tausende von Helfern waren tagelang im Hilfseinsatz. Sie unterstützten die Rettungskräfte der Polizei, der Feuerwehren und des Technischen Hilfswerks.
Einheiten der Bundeswehr und des Bundesgrenzschutzes halfen mit Bergepanzern bei der Räumung der gewaltigen Schneemassen und bei der Suche nach eingeschlossenen oder vermissten Menschen.
Erst viele Tage nach Ende des Schneesturms normalisierte sich das Leben allmählich wieder, Deutschland erwachte aus einer Eiszeit, wie man sie in dieser Wucht kaum für möglich gehalten hätte.
Die Schneestürme in der DDR
Besonders schlimm wüteten die Schneestürme des Jahrhundertwinters 1978/79 im Norden der ehemaligen DDR. Auf der Insel Rügen setzte der erste Schneesturm bereits am 28. Dezember ein. Unter der damaligen politischen Konstellation wurde aber kaum über die verheerenden Folgen des Desasters berichtet.
In Teilen des Landes brach die Energieversorgung komplett zusammen. Die Menschen saßen teils flächendeckend im Dunkeln und Kaltem, Wasser- und Abwasserrohrbrüche waren die Folge.
Die Braunkohletagebaue um Leipzig - Lebensader der DDR-Industrie - kamen fast vollständig zum Erliegen. Für die Wirtschaft war dies ein schwerer Schlag. Braunkohle hat einen hohen Wasseranteil und ist bei der Kälte einfach zusammengefroren. Auch die Kohle auf Zügen oder auf Halden war daher nicht mehr nutzbar.
Einige Jahre vor dem Jahrhundertwinter wurde das Stromnetz der DDR endgültig vom Westen abgekoppelt, somit war auch keine schnelle Energiehilfe aus dem Westen möglich. Die Nordbezirke der DDR versanken binnen weniger Stunden unter einem mehrere Zentimeter dicken Eispanzer - die Folge des zunächst gefrierenden Regens.
Dann setzt ein 78-stündiger Schneesturm ein. Nichts bewegte sich mehr. Rentner, die vom Feiertagskaffeetrinken nach Hause wollten, warteten in den Haltestellenhäuschen am Dorfrand vergeblich auf ihre Busse.
Die Insel Rügen war komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Selbst als viele Rüganer bereits ums Überleben bangten, verkannte die DDR-Führung immer noch das Ausmaß der Katastrophe.
Erst am 3. Januar schickte sie zur Unterstützung Panzer auf die Insel. Für Viele kam die Hilfe zu spät: So wurden die letzten Opfer erst im Frühjahr nach der Schneeschmelze gefunden. Bis heute gibt es keine gesicherten Informationen über die Zahl der Todesopfer in der DDR. Im Westen kamen 17 Menschen ums Leben, im Osten wurden offiziell nur fünf vermeldet.
Ein zweiter Schneesturm tobt mit enormen Schneemassen
"So etwas passiert nur alle 100 Jahre einmal. Heute, nach nur sechs Wochen, ist es zum zweiten Mal passiert". Mit diesen Worten begann die Tagesthemen-Sendung am Abend des 13. Februar 1979. Wieder fegte ein Schneesturm über das Land, dessen Gewalt den ersten Sturm sogar noch übertraf.
Die Schneemassen des Schneesturms vom Jahreswechsel waren noch nicht geschmolzen, als sich das eisige Chaos in weiten Teilen Norddeutschlands noch einmal wiederholte: Wieder brandete sibirische Frostluft nach Norddeutschland und entfesselte dort einen Blizzard mit einer Intensität, wie man sie sonst nur in den arktischen Regionen der Erde kennt.
Obwohl der Sturm bei Weitem nicht so lange anhielt wie der Schneesturm vom Jahreswechsel, schlug er in einigen Regionen sogar noch heftiger zu. So türmten sich nach dem zweiten Sturm bis zu sieben Meter hohe Schneewehen auf und erst Wochen später wurden mit der Schneeschmelze auch die letzten eingeschneiten Autos gefunden und erfrorene Menschen aus ihren eisigen Gräbern befreit.
Ursachen der zweiten Schneekatastrophe
Deutschland hatte eine beispiellose Naturkatastrophe gleich im Doppelpack erlebt, wie sie in dieser Gewalt selbst in den Schneewintern der Nachkriegsjahre beispiellos war. Die meteorologischen Bedingungen, die zum zweiten Schneesturm führten, glichen denen des Silvestersturmes aufs Haar.
Wieder hatte sich 10 Grad milde Luft über ganz Deutschland durchgesetzt und starkes Tauwetter ausgelöst. Über Südskandinavien hielt eisige Frostluft dagegen und brachte den Tauwettervorstoß zum Stillstand.
Dann setzte sich die Luftmassengrenze wieder südwärts in Bewegung und traf das nördliche Deutschland abermals mit einem massiven Schneesturm, der von einem extremen Temperatursturz begleitet wurde. Nur der Süden kam diesmal glimpflicher davon: Dort sickerte die Frostluft nur langsam und ohne markante Wettervorgänge ein.
Aber auch im anschließenden Frühjahr stellten sich aufgrund der im Norden Deutschlands noch lange liegenden Schneemassen immer wieder nasskalte Witterungsphasen ein. Noch bis zum Mai zeugten dort die letzten Schneereste von dem so außergewöhnlichen und überaus arktisch geprägten Winterverlauf.
Fazit
Die erschütternde Bilanz des Jahrhundertwinters 78/89: 17 Menschen verloren allein in der Bundesrepublik infolge von Unfällen, Erschöpfung oder durch Erfrieren das Leben. Mindestens fünf weitere Todesopfer waren in der DDR zu beklagen, wo die Stürme ebenfalls vor allem im Norden und dort ganz besonders verheerend auf der Insel Rügen gewütet hatten. Aber auch unzählige Wild-, Haus- und Nutztiere fielen der eisigen Katastrophe zum Opfer. Sie konnten nicht mehr versorgt und das Vieh nicht gemolken werden, nachdem großflächige Stromausfälle die elektrischen Melkanlagen der landwirtschaftlichen Betriebe unbrauchbar gemacht hatten. Der volkswirtschaftliche Schaden der Unwetterkatastrophe belief sich im Westen Deutschlands auf 140 Millionen D-Mark.